Im Februar 1965 erhält Hövels den Ruf nach Frankfurt. Dort ist er zunächst kommissarischer Leiter und zum 1. Oktober 1965 Direktor der Kinderklinik und Ordentlicher Professor für den Lehrstuhl für Kinderheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Von Februar 1971 bis zum September 1975 ist er Hövels Dekan der Medizinischen Fakultät bzw. des Fachbereichs Humanmedizin. In seine Amtszeit fällt die organisatorische Umstrukturierung der Universitätsmedizin in Frankfurt auf der Grundlage des hessischen Hochschulgesetzes und des hessischen Universitätsgesetzes vom 12. Mai 1970. In der Zeit der Studentenunruhen ist er ein „politischer Dekan“. Bis zu seiner Emeritierung am 30. September 1985 ist er schließlich geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde.
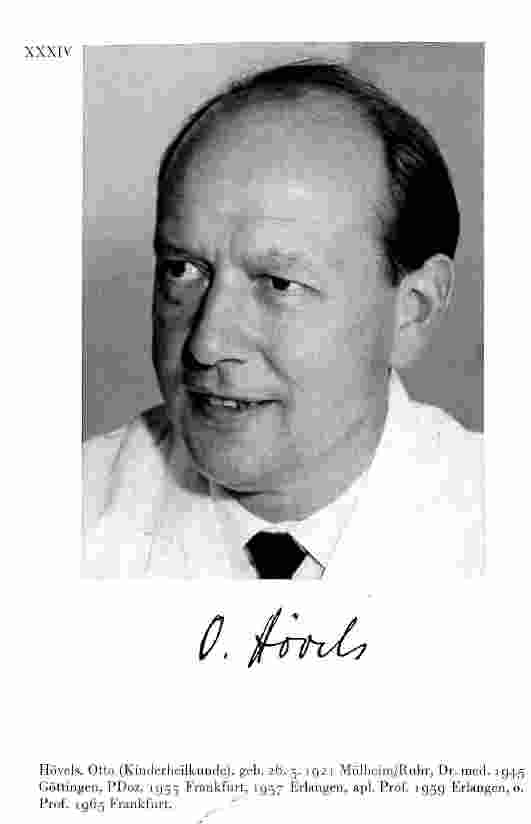

Die Rolle von Hövels im Verlauf der Frankfurter Studentenbewegung
Im Kontext der Aktionen des SDS im November 1967 legt Hövels am 5.12.1967 in einem Vermerk eine Analyse der Situation in der Universität vor, wobei er sich um eine nüchterne Darstellung bemüht:
1. Die Struktur der deutschen Hochschule ist für die exemplarische Demonstration einer autoritären Gesellschaftsstruktur hervorragend geeignet.
2. Die Verhältnisse an den deutschen Hochschulen sind so, daß die Möglichkeit, Massen in Bewegung setzen zu können, groß ist.
3. Dazu ist die deutsche Professorenschaft ein ebenso unfreiwilliger Helfer wie auch sonst ein idealer Gegner. Dank ihrer apolitischen Haltung und einer Selbsteinschätzung, der die Fähigkeiten in der Regel nicht entsprechen, sind Professoren hervorragend geeignet, um sich auf dem falschen Kampfplatz zum Kampf gegen den falschen Gegner verlocken zu lassen. Andererseits ist die Bereitschaft, auf Kritik an der eigenen Person emotional zu reagieren und gegebenenfalls ‘dienstlich’ zu werden, auch unter deutschen Professoren nicht gering. Die daraus resultierenden Verwaltungsakte sichern dem SDS Publizität und Solidaritätsbezeugungen großer Studentenmassen. In der Spekulation auf die unfreiwillige Mithilfe der Professoren hat sich der SDS bis heute leider nicht getäuscht.
4. Deswegen kann sich der SDS, selbst wenn er sein Ziel, eine demokratisierte Universität, für utopisch hält, mit Erfolg der Aufgabe widmen, die Widersprüche in der Universität darzustellen, und damit ihre Krise zu beweisen.
5. Dabei erhofft man ein Übergreifen der Unzufriedenheit auf die Arbeiterschaft, denn – um es noch einmal deutlich zu sagen: Der SDS versteht seine Tätigkeit an der Hochschule nur als Randfunktion des Klassenkampfes. Daher erklärt sich der entscheidende Kampf des SDS gegen die Notstandsgesetze ebenso wie seine ersten Versuche, die Schülerschaft in seine Bemühungen einzubeziehen.
Da sich die Studenten des SDS als Vorkämpfer der Unterdrückten verstehen, sehen sie in den revolutionären Bewegungen der dritten Welt ihren natürlichen Verbündeten. Ihre Sympathien für Rotchina, die beständige Agitation gegen den Vietnam – Krieg und die Anti – Schah – Demonstrationen sind deswegen kein Zufall. Daß dem SDS sein Engagement gegen koloniale Unterdrückung und Notstandsgesetze Sympathisierende bringt, die sich dem politischen Gespräch stellen, ist ein erwünschtes Nebenprodukt dieser Tätigkeit. – Die Taktik des SDS ist ebenso einfach wie wirksam: Es wird zunächst versucht, die unsichtbaren Konflikte mit einer in Frage gestellten Autorität dadurch sichtbar zu machen, daß man ganz bewußt den Konfliktfall provoziert. Reicht dazu die gewährte Diskussion nicht aus, oder wird sie verweigert, versucht man, sie, unter Umständen auch durch Gesetzesübertretungen, zu erzwingen. Im daran sich entzündenden Konflikt ist ein möglichst obrigkeitliches Verhalten der Universitätsbehörden erwünscht. Es erzeugt bei vielen Studenten Sympathien für die ‘Unterdrückten ‘. Diese können daraufhin den Studenten ihre eigene Abhängigkeit von der gleichen autoritären Herrschaftsform zeigen. Sie sollen dadurch zur Diskussion dieses Faktums und seiner Ursachen aufgeschlossen werden. Der Fachausdruck für diesen Prozeß heißt ‘Bewußtseinsbildung’. – Setzt sich die Universitätsbehörde formal ins Unrecht, ist dies ein zusätzliches willkommenes Geschenk. Sie vermehrt damit automatisch den Kreis der ansprechbaren Studenten. Das gleiche gilt, wenn notwendige Abwehrmaßnahmen unverhältnismäßig heftig oder ungeschickt ausfallen. Daß in dieser Beziehung zweifellos tragischste Beispiel ist der Polizeieinsatz in Berlin, der schließlich zum Tode von Benno Ohnesorg führte, und der Folgen für die ganze Bundesrepublik hatte. – Ist der Konflikt bewußt gemacht (transparent geworden), geht es mit größerer Anhängerzahl in die nächste Runde usw. Diese Taktik hat bisher an allen Orten planmäßig funktioniert. Darum wird es solange keine Ruhe geben, bis der SDS sicher sein kann, mit dieser Methode nicht mehr weiterzukommen. – Man tut jedoch dem SDS Unrecht, wenn man nicht erkennt, daß seine Ziele sich aus radikal humanitären Überlegungen leiten lassen. Man wird auch der Gruppe zwei weitere Fakten zugestehen müssen: – Wie andere Institutionen der Studentenschaft hat sie jahrelang das – allerdings radikal fragende – Gespräch mit der Universität gesucht. Dieser radikale Ansatz der Fragestellung war entweder unerwünscht oder wurde in seiner Bedeutung nicht erkannt. Das Ergebnis war stets gleich: Eine ernsthafte geistige Auseinandersetzung hat es bis heute nicht gegeben. – Es war deswegen auch nicht möglich, nennenswerte Reformen an den Universitäten zu erreichen. – Das daraus gezogene Fazit des SDS lautet: Mit Professoren in Herrschaftspositionen der Universität ist nicht zu reden. Mit Professoren ohne Herrschaftspositionen lohnt es sich nicht zu reden, weil es keine Folgen hat. Dies ist ein Glaubenssatz des SDS, der den anderen Studenten wieder und wieder gesagt wird. Auf ihn wird bei jedem Mißerfolg dieser Studenten im Gespräch mit Professoren verwiesen. Auch hier ist der SDS vermutlich angreifbar. – Ein zweites Faktum ist, daß es sich der SDS nicht leicht macht. Seine Konzeption hat er in langer und ernster, geistiger Arbeit entwickelt. Eine Durchsetzung seiner Forderungen würde den Studenten in Bezug auf die fachlichen Anforderungen das Studium nicht leichter, sondern schwerer machen. Auch die an seine Mitglieder gestellten Anforderungen sind nicht gering. Die Folge ist, daß der SDS an fast allen Universitäten der Schrittmacher, wenn nicht der Führer der studentischen Emanzipationsbewegung ist. – Seit 1964 stehen mit dem SDS in verabredeter enger Aktionsgemeinschaft: – Der sozialistische Hochschulbund (SHB). Er unterscheidet sich vom SDS nicht sehr erheblich. Sein Geldgeber ist die SPD. – Die humanistische Studentenunion (HSU). Ihr Geldgeber ist vermutlich die humanistische Union. – Der liberale Studentenbund (LSD). Seine Finanzquelle ist die FDP . – Die deutsch – israelische Studentengruppe (DIS). Ihre Finanzquelle ist mir nicht bekannt. – Je nach Hochschule und nach den gegebenen Situationen kommen zur Unterstützung dieser Gruppen hinzu: Die evangelische Studentengemeinde (ESG). Dies trifft beispielsweise auf Berlin und Tübingen zu. – Der Ring christlich demokratischer Studenten (RCDS), die Hochschulorganisation der CDU – CSU. Die ESG und RCDS erstreben eine Realisierung der studentischen Vorstellungen auf evolutionärem Wege. In Konfliktsituationen mit den Hochschulbehörden standen beide so gut wie immer in einer Linie mit den übrigen politischen Gruppen. – Eine Forderung, die wohl von allen Studenten erhoben wird, ist die Studienreform und eine Verbesserung der zum Teil unerträglichen Arbeitsmöglichkeiten. – Es wäre falsch, hier auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu verweisen. Die Vorstellungen der Studenten weichen nämlich in zwei wesentlichen Punkten von denen des Wissenschaftsrat es ab. Sie erstreben – und dies ist bemerkenswert wenig bekannt – , daß auch das sogenannte Grundstudium im Gegensatz zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates ein wissenschaftliches Studium bleibt. Dies ist am klarsten in entsprechenden Stellungnahmen der Vereinigung deutscher Studentenschaften (VDS) ausgedrückt. – Darüber hinaus bezweifeln alle politischen Studentenverbindungen, daß die derzeitige Universitätsstruktur ihrer Qualität nach in der Lage ist, eine solche Reform überhaupt zu leisten. Sie machen dem Wissenschaftsrat nicht unberechtigt den Vorwurf, daß er die Frage der Studenten, soweit sie die Universität betrifft, nur quantitativ in Bezug auf die Zahl der benötigten Lehrkräfte, und qualitativ, d. h. in Bezug auf die Strukturierung des vermehrten Lehrkörpers beantwortet hat. – Erst, nachdem die Universitäten – insgesamt bemerkenswert unreflektierter als die Studentenschaft – sich gemeinsam mit den Kultusministerien an die Verwirklichung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates machte, ohne ernsthaft auf die studentischen Vorstellungen einzugehen, wurde allgemein als logische Folge eine Forderung der Studentenschaft nach qualifizierter Mitbestimmung in allen akademischen Gremien laut. Kann doch die Studentenschaft nur noch so hoffen, eine Reform des Studiums an den Wissenschaftlichen Hochschulen zu bekommen. – Darüber hinaus fragt der SDS radikal nach der Gesellschaftsbezogenheit der Wissenschaft. Ihn interessierte zwar was, wem, wann durch wen beigebracht wird. Er erstrebt darüber hinaus, daß sich Lehrer und Studierende darüber klar werden, welche Bedeutung Lehre und Entwicklung in der Wissenschaft für die Gesellschaft haben können. – Ist es wirklich so schwer, im Zeitalter von Atom – und Napalm – Bomben dem Naturwissenschaftler, und nach dem Ciba – Foundation Symposium einer internationalen Elite von Genetikern, dem Mediziner klar zu machen, daß viele Lehrinhalte seines Faches immanent einen Gesellschaftsbezug enthalten? – Wie schon bei manchen anderen studentischen Forderungen hat es häufig zwischen Studenten einerseits, Professoren und Öffentlichkeit andererseits Mißverständnisse gegeben: Es lag nahe, daß philosophisch – dialektisch wenig geschulte und mit der Terminologie der Soziologen nicht vertraute Naturwissenschaftler und Mediziner wähnte, die SDS – Studenten wollten die Lehrgegenstände der naturwissenschaftlichen Fächer durch Gesellschaftswissenschaften ersetzen. Sie lehnen dies verständlicherweise krass ab. Die Studenten fühlten sich nun ihrerseits mißverstanden. Sie nannten Wissenschaftler, die nicht bereit zu sein schienen, mit ihnen diese eminent wichtige Bezüge ihres Faches zu diskutieren, ‘Fachidioten’. Diese Vokabel wurde verständlicherweise unreflektiert aufgenommen und entsprechend emotional verarbeitet. Die Studenten proklamierten, eine Wissenschaft, die Erkenntnisse produziert, ohne zu fragen, was daraus einmal entstehen könne, und die deswegen auch unmenschlichen Vorhaben ihre Hilfe zu leihen in der Lage wäre, zerstören zu wollen. Wir verstanden daraufhin, sie wollten die Wissenschaft zerstören. Und so weiter, und so weiter. – Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß alle Bemühungen um die Verwirklichung der studentischen Forderungen, sei es durch Mißverständnisse, sei es durch Unverständnis, selten durch Böswilligkeit, nur zu minimalen Erfolgen geführt haben. – Wenn wir heute den radikalen, in ultimativer Form vorgetragenen Forderungen der Studenten gegenüber stehen, können wir darüber zwar nicht glücklich sein. Wir müssen aber bedenken, daß sie von Studentenorganisationen vorgetragen werden, die seit Jahren versuchen, mit den Spitzengremien der Hochschulen ins Gespräch zu kommen. Daß sie darüber hinaus ihre Bemühungen im wesentlichen auf Berlin konzentriert haben, mag daran liegen, daß ihnen diese Universität ihrer Geschichte und Struktur nach als besonders geeignet erschien. Daß sie es nicht war und daß West – Berlin sich als ein denkbar ungeeigneter Ort zur öffentlichen Austragung von Konflikten erwies, kann unser aller Schicksal bestimmen. – Die deutschen Universitäten gehen in die notwendige Auseinandersetzung mit nennenswerten Handicaps:
1. Die Professorenschaft ist auf die Ereignisse weitgehend unvorbereitet und steht ihnen meist ratlos gegenüber.
2. Von Ausnahmen (Konstanz, Ulm, Bochum) abgesehen, ist die Reformkonzeption der Hochschulen wie des Wissenschaftsrates. Diese wurde jedoch vornehmlich dazu entworfen, um wenigstens die gröbsten Mängel abzustellen. Schon jetzt läßt sich erkennen, daß sie nicht ausreichen wird, um den zu erwartenden Andrang von Studenten aufzunehmen. Man wird zugeben müssen, daß die leeren Hände der Universitäten nicht gerade für die Fähigkeiten der bisherigen Führungsschichten sprechen.
3. Den Universitäten fehlt ein effektiver Führungsapparat, der den bevorstehenden Auseinandersetzungen gewachsen wäre. Ihnen fehlt bis jetzt auch eine hinreichende Anzahl von qualifizierten und einsatzbereiten Führungskräften.
4. Im Lehrkörper der Universitäten bestehen erhebliche soziale Spannungen zwischen Ordinarien, Nichtordinarien und Assistenten. Sie sind bisher latent geblieben, können aber in einer möglichen Auseinandersetzung zu einem nicht voraussehbaren Zeitpunkt zusätzlichen Zündstoff liefern.
5. Das Prinzip der Repräsentation unserer Hochschulen durch die Ordinarien bietet einer rationalen Diskussion erhebliche Angriffspunkte. Dies gilt um so mehr, als das Prinzip der Selbstkontrolle der Ordinarien nicht so funktioniert, daß offenbare Mißstände wirksam abgestellt werden können. – Wie bereits in Berlin bewiesen wurde, ist die Gefahr, daß die Entwicklung aus der Kontrolle der Universität gerät, sehr groß.
Aus all dem ergibt sich, daß mit den Entscheidungen über die Forderungen der Studentenschaft wesentlich mehr auf dem Spiel steht, als der Prozentsatz der Studentenvertreter im satzungsgebenden Konzil. Erkennen wir die Situation nicht lehnen die meines Erachtens berechtigten Forderungen der Studenten starr ab, oder lassen wir uns provozieren, sind nach einem daraus notwendigerweise entstehenden Konflikt mit der Studentenschaft folgende Entwicklungen möglich:
1. Es kann zu einer obrigkeitlichen Lösung kommen, durch die die Landesregierung die Anteile der einzelnen Gruppen im satzungsgebenden Konzil festsetzt.
2. Die Ordnung an der Universität kann durch Kampfmaßnahmen der Studentenschaft so aus den Fugen geraten, daß ein Einsatz der Polizei unvermeidbar wird.
Beide Entwicklungen wären verhängnisvoll. Ob sie überhaupt noch zu verhindern sind, hängt meines Erachtens daran, ob wir die Situation erkennen und bereit sind, daraus entscheidende, für viele von uns schmerzliche Konsequenzen zu ziehen. Auch wir sind drauf und dran, einer entschlossenen kleinen Gruppe, die zweifellos mehr als die von allen Studenten geforderte Universitäts- und Studienreform erstrebt, durch die Verweigerung berechtigter Forderungen nach Reformen, die Massen in die Arme zu treiben, die ihre weiterreichenden Aktionen allein wirksam machen können. – Die deutschen Universitäten sind trotz – meiner Meinung nach wegen – ihrer apolitischen Haltung zu einem Politikum ersten Ranges geworden.„
Todesanzeige Hövels 30. September 2014

